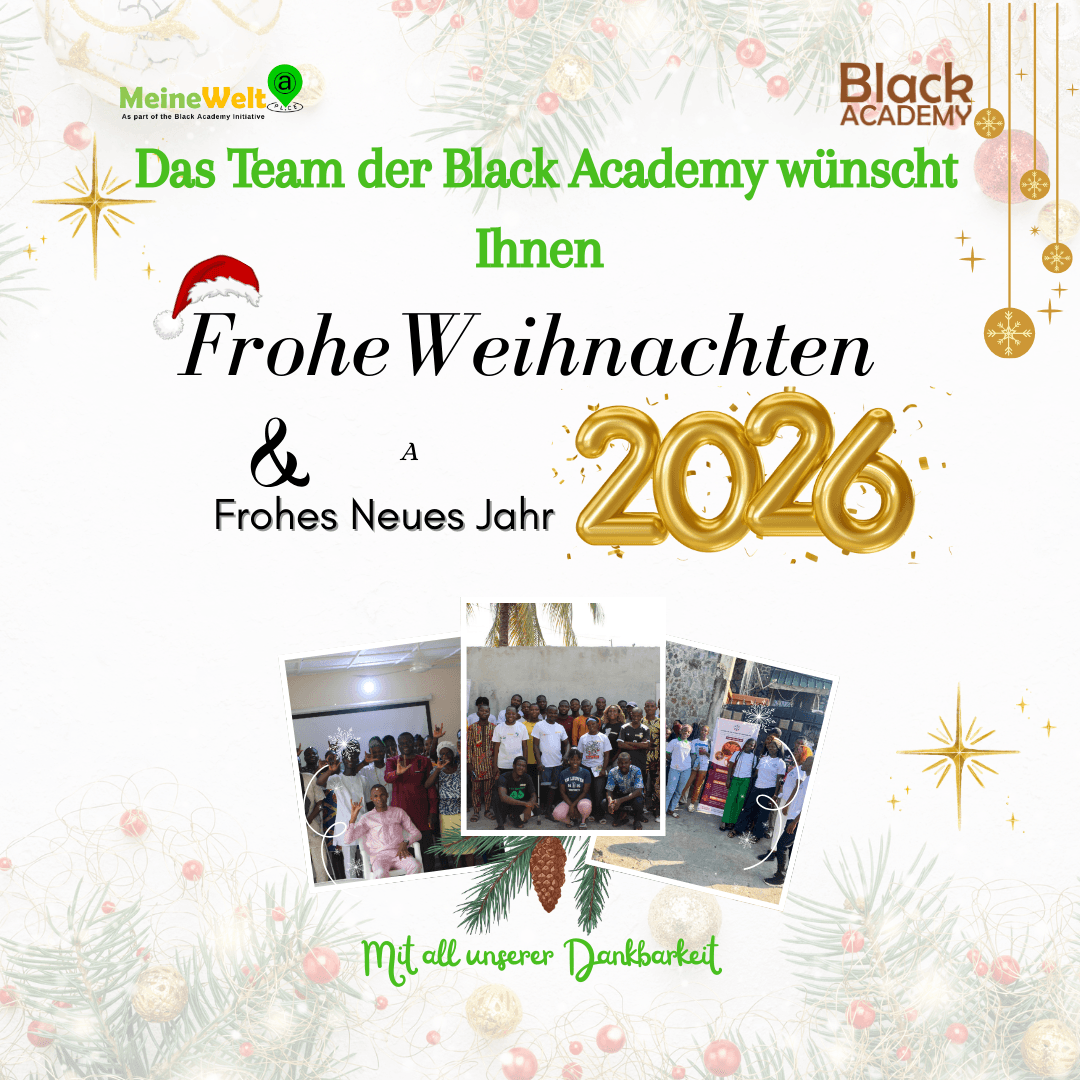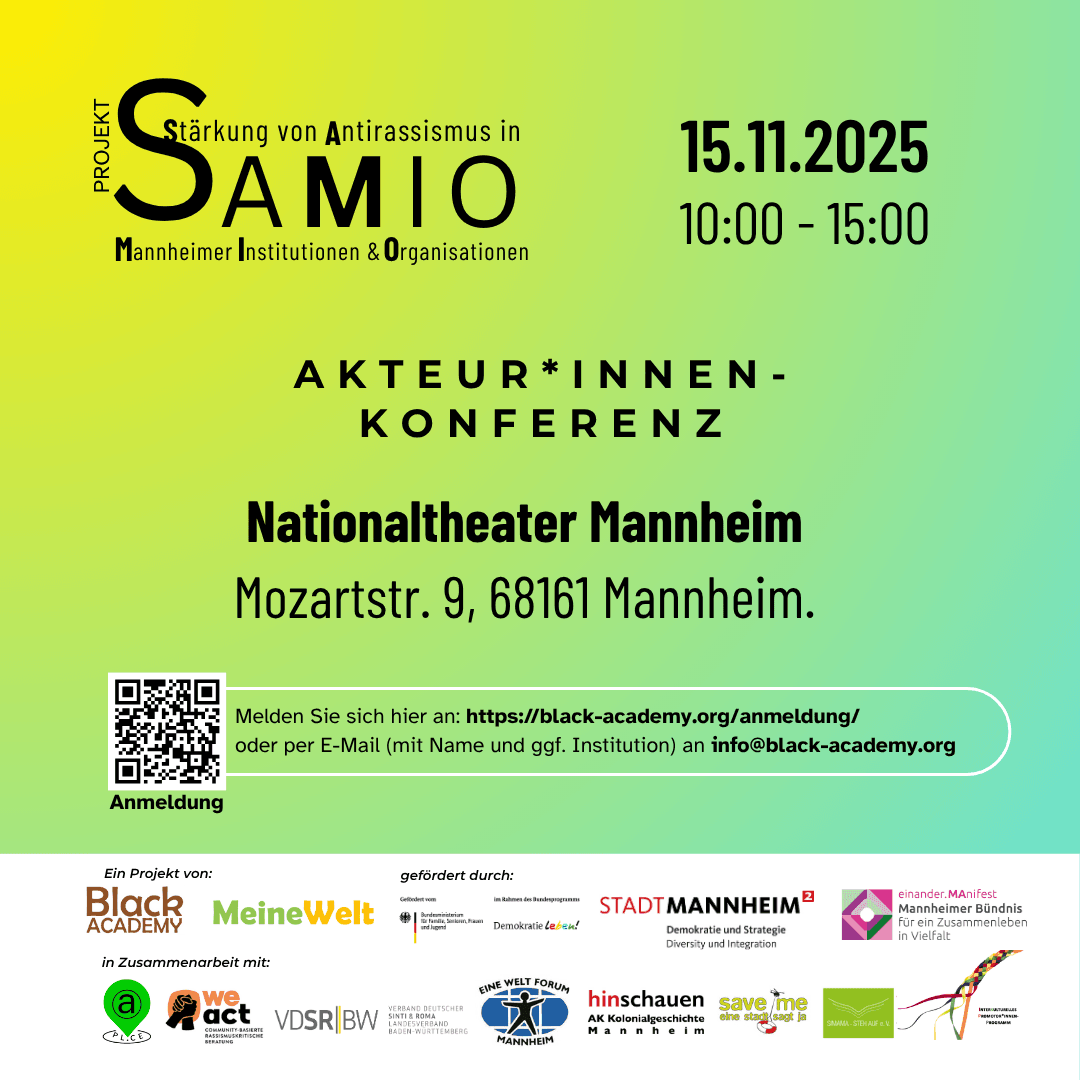Am 15. November 1884 begann in Berlin ein Ereignis, das die Welt nachhaltig prägen sollte: Vertreter von 14 Staaten, darunter alle europäischen Großmächte, die USA und das Osmanische Reich, trafen sich zur sogenannten „Berliner Konferenz“. Ziel war die koloniale Aufteilung Afrikas – ein Vorhaben, das den Höhepunkt des „Wettlaufs um Afrika“ markierte. In diesen Verhandlungen, die bis Februar 1885 andauerten, ging es um wirtschaftliche Interessen und geopolitische Kontrolle. Doch während der Kolonialmächte ihre Herrschaft festigten, blieben die betroffenen afrikanischen Gesellschaften völlig ausgeschlossen. Ihre Stimmen wurden ignoriert, ihre Länder zum Spielball imperialer Mächte.
Die Berliner Konferenz war der Startschuss für eine Welle kolonialer Gewalt und Ausbeutung, die ganze Kontinente erschütterte. Afrika wurde in koloniale Verwaltungsstrukturen gezwungen, Grenzen wurden willkürlich gezogen, ohne Rücksicht auf ethnische und kulturelle Zusammenhänge. Das Ergebnis war eine anhaltende politische Instabilität, die bis heute viele afrikanische Staaten prägt.
140 Jahre später stehen wir vor der Frage: Wie dekolonial ist die heutige Welt? Die Antwort fällt ernüchternd aus. Die kolonialen Wunden sind noch längst nicht verheilt, und der globale Norden hat es vielfach versäumt, seiner historischen Verantwortung gerecht zu werden.
Für Deutschland markierte die Berliner Konferenz den Eintritt in die Reihe der imperialen Mächte. Unter der Leitung Otto von Bismarcks war das Kaiserreich bestrebt, sich koloniale Gebiete zu sichern, die wirtschaftliche Vorteile und internationalen Einfluss versprachen. In Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania, führte die Kolonialherrschaft zu einer der grausamsten Repressionen des deutschen Kolonialreiches: der Maji-Maji-Rebellion (1905–1907). Diese Bewegung, getragen von der Hoffnung auf spirituellen Schutz und die Befreiung von kolonialer Unterdrückung, wurde mit brutaler Gewalt niedergeschlagen. Deutsche Truppen vernichteten Dörfer, zerstörten Felder und führten gezielte Hungerstrategien durch. Tausende von Menschen verloren ihr Leben – nicht nur durch die Kämpfe, sondern auch durch die Hungersnöte, die auf die Zerstörung der landwirtschaftlichen Grundlagen folgten. Diese Verbrechen wurden kaum aufgearbeitet, und die Erinnerungskultur beschränkt sich, wenn überhaupt, auf Gedenkveranstaltungen.
Menschenrechte als widersprüchliches Ideal
65 Jahre nach der Berliner Konferenz, mit der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948, hoffte die Welt auf einen neuen Anfang. Diese Erklärung versprach universelle Rechte für alle Menschen – ein scheinbarer Bruch mit der Vergangenheit. Doch in der Praxis wurden diese Rechte oft selektiv angewendet. Während in Europa und Nordamerika Fortschritte bei der Wahrung von Menschenrechten gemacht wurden, blieben die kolonialen und postkolonialen Gebiete weiterhin Schauplätze massiver Menschenrechtsverletzungen.
Die Doppelmoral westlicher Demokratien wurde in den Jahrzehnten nach 1948 immer deutlicher. Kolonialmächte wie Großbritannien, Frankreich und Belgien setzten ihre Herrschaft mit brutaler Gewalt fort, trotz der feierlichen Proklamation universeller Menschenrechte. Im Belgischen Kongo wurden bis in die 1940er Jahre Menschen zu tödlicher Zwangsarbeit auf Plantagen gezwungen. Die unmenschlichen Arbeitsbedingungen führten zum Tod Tausender. In Südafrika und Namibia manifestierte sich die Apartheid in der systematischen Diskriminierung und Enteignung der schwarzen Bevölkerung.
Die Menschenrechtskonvention blieb in diesen Kontexten ein leeres Versprechen. Friedliche Proteste, wie das Massaker von Sharpeville 1960 in Südafrika, bei dem 69 Menschen von der Polizei erschossen wurden, verdeutlichen die Ignoranz gegenüber den erklärten universellen Werten. Die Ermordung politischer Führer wie Patrice Lumumba (1961) und Thomas Sankara (1987) zeigt, wie systematisch jede Bewegung, die die koloniale Ordnung infrage stellte, unterdrückt wurde – oft mit stillschweigender Unterstützung westlicher Staaten.
Das unzureichende Tempo der Dekolonialisierung
Auch heute bleibt die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit unzureichend. Deutschland hat erst kürzlich seine Verantwortung für den Völkermord an den Herero und Nama (1904–1908) im heutigen Namibia teilweise anerkannt, doch die konkreten Schritte zur Entschädigung und Wiedergutmachung bleiben begrenzt. Der Rückgabeprozess von geraubten Kulturgütern, wie den Benin-Bronzen, erfolgt schleppend und oft nur auf massiven Druck der Herkunftsländer. Gleichzeitig bleiben Museen mit geraubten Kulturgütern gefüllt, und der öffentliche Diskurs dreht sich oft mehr um die vermeintlichen „zivilisatorischen“ Beiträge der Kolonialzeit als um die Anerkennung der Gräueltaten und ihrer Folgen. Selbst in demokratischen Ländern wie Deutschland befinden sich immer noch menschliche Überreste aus kolonialen Kontexten in Museumskellern.
In vielen westlichen Ländern fehlt ein tiefes gesellschaftliches Bewusstsein für die Verbrechen des Kolonialismus. Frankreich behält durch militärische Präsenz und die Kontrolle über den CFA-Franc weiterhin Einfluss in afrikanischen Staaten.
Während die universellen Menschenrechte gefeiert werden, bleibt die koloniale Dimension der Menschenrechtsverletzungen vielfach ein Tabuthema. Die universellen Menschenrechte, die 1948 proklamiert wurden, stehen in einem schmerzhaften Widerspruch zu der Realität, die Millionen von Menschen in den ehemaligen Kolonien erlebten und weiterhin erleben.
140 Jahre und kein bisschen weiser
Die kolonialen Wunden sind noch offen, die Fortschritte bestenfalls kosmetisch. Ohne ernsthafte Aufarbeitung bleibt die Berliner Konferenz kein Relikt der Vergangenheit, sondern ein Mahnmal für andauernde Ungerechtigkeit.
Der dekoloniale Fortschritt ist Stückwerk, die Aufarbeitung eine Farce. Es ist höchste Zeit, sich der historischen Schuld zu stellen und konkrete Schritte zur Wiedergutmachung zu unternehmen. Denn ohne echte Taten bleibt die Vision universeller Menschenrechte ein hohles Versprechen.
Na dann, Berliner Konferenz – ein Jubiläum, das nach wie vor keine Feier wert ist.